Eine Einführung in das Thema „Digitalisierung & wehrhafte Demokratie“ gibt uns Çiğdem Uzunoğlu, seit Januar 2025 die Direktorin und Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Mit wehrhafter Demokratie, mit Digitaler Partizipation als Antwort auf Gefahren von Desinformation sowie der Notwendigkeit Digitaler Souveränität setzt sie sich in ihrer Arbeit seit vielen Jahren auseinander. Im hier folgenden Interview spricht sie über die Medienlandschaft in Deutschland und den aktuellen Zustand der Gesellschaft – und über die Bereiche, in denen eine auf Wissen und Haltung basierende Mediennutzung zur Förderung demokratischer Ziele beitragen kann, die gemeinsam verhandelt werden.
Liebe Çiğdem,
… was sind Deiner Einschätzung nach die Aufgaben, die wir in unseren verschiedenen Rollen in einer demokratischen Mediengesellschaft haben oder übernehmen sollten?

Unsere Medienlandschaft ist unabhängig, vielfältig und frei – das ist eine ihrer größten Stärken und einer der Grundvoraussetzungen für eine wehrhafte Demokratie. Das Zusammenspiel von Medien und Demokratie prägen auch wir und wir alle tragen die Verantwortung nicht nur für ihre Verteidigung, sondern auch für ihre Mitgestaltung. Und wir müssen den Dreiklang bewahren aus unserem kompetenten Medienverhalten, aus digitaler Souveränität und aus einer unabhängigen, von Prinzipien der Qualität bestimmten Medienlandschaft. Denn Vielfalt, unterschiedliche Perspektiven, Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrechte, Pluralität müssen insbesondere im Zeitalter von Tech-Plattformen und intransparenten Algorithmen gewährleistet werden.
Eine wehrhafte Demokratie braucht eine wehrhafte, unabhängige und vielfältige Medienlandschaft. Diese hat unter anderem mit ihren journalistischen Beiträgen eine unverzichtbare Aufgabe für die gesamte Öffentlichkeit, in der sich unser demokratischer Diskurs abspielt.
Die Politik wiederum ist gefordert, den rechtlichen Rahmen zu setzen, der unsere Demokratie schützt. Das umfasst nicht nur den Schutz vor verfassungsfeindlicher Propaganda, Hassrede und gezielter Desinformation – gerade im digitalen Raum – sondern auch die Sicherung unseres Rechts auf freie Meinungsäußerung. Schutz ist wichtig! Freiheit im demokratischen Rahmen ist unverzichtbar.
Zudem liegt es in der Verantwortung der Bildungspolitik, Medienkompetenz und Medienkritik als zentrale Bestandteile der demokratischen Bildung zu verankern. Wer gelernt hat, zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Information und Manipulation zu unterscheiden, ist weniger anfällig für Desinformation – und stärkt damit die demokratische Resilienz der Gesellschaft. Medienbildung ist deshalb keine „einmalige Aufgabe“, sondern ein lebenslanger Prozess, dem wir uns, mehr denn je, alle stellen müssen. Es geht um digitale Souveränität, um journalistische Qualität und um den Schutz von Vielfalt, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten – insbesondere in einer Zeit, in der algorithmische Logiken und Tech-Plattformen zunehmend Einfluss auf unsere Informationsräume nehmen.
Die Politik muss zudem bildungspolitische Themen im Blick haben. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass eine gelungene Vermittlung von Medienkompetenz und auch von Medienwachsamkeit dabei hilft, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden und damit diejenigen zu schwächen, die Desinformation aus ihren unterschiedlichen Motiven heraus streuen. So entsteht eine kritische Mediennutzung – und diese ist Voraussetzung für den kritischen, demokratischen Mediendiskurs. Den Rahmen unter anderem für solche bildungspolitische Themen zu schaffen und zu verankern, liegt in der Verantwortung der Politik. Uns mit ihnen auseinanderzusetzen, uns darauf einzulassen, dass wir unser Leben lang lernen und dazulernen müssen – das ist die Verantwortung von uns allen. Wir alle – als Bürgerinnen und Bürger, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Teilnehmende am gesellschaftlichen Leben – tragen Verantwortung für das demokratische Miteinander. In unseren unterschiedlichen Rollen müssen wir uns bewusst machen, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Sie lebt von unserer aktiven Mitwirkung.
Bei einem kritischen Blick auf die derzeitige Mediengesellschaft: Wo siehst Du derzeit die dringendsten Herausforderungen im Kontext Demokratie, wo sind bedrohliche Entwicklungen festzustellen und wo könnten Lösungen liegen?
An erster Stelle steht hier für mich Desinformation. Besonders die Jüngeren, aber beileibe nicht nur sie, beziehen Nachrichten zunehmend aus sozialen Medien. Dies ist aber die falsche Form der Nachrichtenübermittlung. Wo ist die Prüfung, wo die redaktionelle Aufbereitung, wo die Ausgewogenheit? Und was ist mit der Vollständigkeit des Bildes, das uns geboten wird?
Statt demokratischer Leitprinzipien bestimmen ökonomische Logiken wie Datenverwertung, Nutzerbindung und algorithmische Prozesse die Struktur dieser Plattformen.
Wir wissen, dass die hinter den Plattformen agierenden Algorithmen uns die Dinge liefern, von denen sie „gelernt“ haben, dass sie uns interessieren. Wird unsere Wahrnehmung von Realität, von Gesellschaft aus diesem Grund ärmer? Plakativer? Oder antagonistischer? Auf diese Weise kann die vielzitierte Bubble entstehen, in die nichts Unerwartetes mehr eindringt, das unseren Blick auf die Wirklichkeit vielleicht bereichern und unsere Meinung erweitern könnte. Was ist, wenn wir bei unserer Nutzung von sozialen Medien immer wieder auf die gleichen Nutzer treffen? Bewegen wir uns in einem permanenten Flow von gegenseitiger Bestätigung in diesen Echokammern? Wo bleibt die Gegenmeinung, wo sind die kritischen Diskursräume, an der wir unsere Haltung überprüfen oder womöglich sogar revidieren können – an der wir aber auf jeden Fall auch wachsen können.
Und abseits der solchermaßen entstehenden virtuellen Gruppen, in denen wir uns bewegen: Was ist, wenn Menschen in den Wirkkreis von Hass und Hetze geraten? Ich rede hier nicht nur über die Gruppen in unserer Gesellschaft, die ihren Hass bewusst und gezielt ins Virtuelle exportieren. Sie zu erreichen, ist kaum noch möglich. Aber was ist mit jenen, die – ohne gezielt nach solchen antidemokratischen Positionen zu suchen – auf solche Inhalte stoßen? Wie können wir sie davor schützen, sich diese, aus Unkenntnis womöglich, zu eigen zu machen oder weiterzuverbreiten?
Hier sehe auch ich im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte, die in keiner Weise neu sind: Wir müssen die Kompetenzen in der Bevölkerung fördern und stärken, Nachrichten von Meinung und bloße Meinung von Desinformation und Hass zu unterscheiden. Hierzu gehört neben kritischer, hinterfragende und reflektierter Mediennutzung auch das Wissen darum, dass hinter letzterem immer auch der Angriff auf Menschen oder auf demokratische Strukturen steht. Die Vermittlung von Medienkompetenz und kritischer Mediennutzung muss, denke ich, deshalb immer mit der Aufklärung dazu einhergehen, dass wir alle uns in dem Moment, in dem wir digital und öffentlich kommunizieren, im weiteren Sinne gesellschaftlich und demokratisch positionieren – im Guten wie im Schlechten.
Lernen darf nicht auf die Schule beschränkt bleiben. Angesichts der sich rasant verändernden Medienwelt – etwa durch Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz – braucht es auch außerhalb der Schule kontinuierliches Lernen. Besonders in unserer gesellschaftlichen und medialen Teilhabe sind stetig neue Kompetenzen gefragt.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob wir die Rolle seriöser Medien, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht stärker als Bildungsakteure begreifen müssen. Ihre Aufgabe, zu informieren und zur Meinungsbildung zu befähigen, könnte einen noch wichtigeren Beitrag zum lebenslangen Lernen leisten.
Denn ohne Medienkompetenz kann Demokratie nicht gestärkt werden: Nur wer unterscheiden kann, was wahr ist, kann sich in einer komplexen Welt orientieren. Wahrheit ist nicht verhandelbar – sie muss erkannt und akzeptiert werden.
In diesem Zusammenhang wird bereits seit einiger Zeit diskutiert (und auch mit Sorge betrachtet), dass Teile der Bevölkerung sich aus dem demokratischen öffentlichen Diskurs verabschieden und für Angebote etwa des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der seriösen Nachrichtenpresse – als Lügen- oder Mainstreampresse diffamiert – nicht länger empfänglich zu sein scheinen. Oft wird unterstellt, hier würde nicht Wahrheit, sondern „von oben“ aufgezwungene Meinung verbreitet. Bevor sich dies weiter ausweitet: Womöglich helfen im Lernprozess auch kleinere Ansätze – etwa die, die unterschiedliche Medientypen definieren: Nachrichten sind Nachrichten, Reportagen sind Reportagen, Meinungen – als solche gekennzeichnet – sind Meinungen.
Uns dieses Wissen anzueignen, ist unsere Aufgabe als Individuum, als Bürgerinnen und Bürger. Wir tragen jedoch nicht die alleinige Verantwortung, denn auch die, die uns die Plattformen zur Verfügung stellen, auf denen wir kommunizieren und die unsere Öffentlichkeit prägen, müssen sich berechtigten Forderungen stellen. Die kommerziellen Techkonzerne aus den USA und aus China, die diese zur Verfügung stellen und den Markt hierfür an vielen Stellen dominieren, müssten die von ihnen verwendeten Algorithmen transparent machen. Sie müssten, trotz international unterschiedlicher Gesetzeslage zum Recht auf freie Meinungsäußerung, Inhalte besser prüfen und schneller aktiv werden, wenn berechtigte Beschwerden nicht nur zu Desinformation, sondern insbesondere auch zu Hass und Hetze eingereicht werden. Wie wunderbar wäre es, wenn ein Tool entwickelt würde, mit dem sich Nachrichten schnell und unkompliziert auf ihren Wahrheitsgehalt, auf die Faktengrundlage überprüfen ließen. Es gibt bereits eine ganze Reihe von Fact-Check-Angeboten (etwa den ARD-faktenfinder oder den Faktencheck der Deutschen Welle, um nur zwei zu nennen) oder auch den Google Fact Check Explorer, den man sich wie eine Faktencheck-Suchmaschine vorstellen soll. Aber diese Angebote setzen eine gewisse Eigeninitiative der Nutzerinnen und Nutzer voraus. Man kann eben nicht mit einem Klick prüfen, wie Meldungen einzuschätzen sind. Also bleibt diese Herausforderung: Wie sollen wir umgehen mit der Informationsflut, ohne Prüfung und ohne Regeln?
Wichtig ist, auf der politischen Ebene, die Förderung von Gegengewichten: von pluralistischen Angeboten, von unabhängigen (Qualitäts-)Medien, von regionaler Presse. Was immer öfter gefordert wird, ist das Nachdenken über eine Plattform diesseits der internationalen Konzerne: eine, die öffentlich gefördert wird, die unabhängig und etwa europäischem Recht unterworfen ist. Eine, die Meinungsfreiheit wahrt, aber antidemokratische, rassistische, antisemitische Beiträge löscht; eine, die es sich zur Aufgabe macht, einen Diskursraum zu eröffnen und zu pflegen, der ohne Desinformation und Hass ist. Auch hier die Frage: Können die Prinzipien von öffentlich-rechtlichem Rundfunk mit seinen festgelegten Aufträgen zu Information, Meinungsbild, Teilhabe in solche Überlegungen einfließen?
In diesen Kontext schließlich, ebenfalls zum Stichwort ÖRR, gehört auch das – an vielen Stellen bereits begonnene – Nachdenken über die Wirkmacht der Bevölkerung. Wie kann diese stärker in die Mitgestaltung des Programms eingebunden werden, welche Rückkanäle, welche Partizipationsmöglichkeiten sind sinnvoll? Wie können – immer innerhalb der Grenzen des demokratischen Spielfelds, versteht sich – Angebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aussehen, um auch die wieder anzusprechen, die sich abwenden?
Welche Rollen hat – positiv wie negativ – KI in einer medial vermittelten Gesellschaft?
Zuallererst: KI ist eine Riesenchance, eine völlig neue effiziente Art der Informationsbeschaffung. Sie recherchiert, sie fasst zusammen, sie textet, sie editiert. Sie kann übersetzen – Sprachbarrieren entfallen. Sie entwickelt mit unserer Hilfe Ideen und Lösungen. Sie kann uns in unserer Kreativität unterstützen. Und dies ist lediglich ein kleiner Ausschnitt ihrer Einsatzmöglichkeiten. Über ihr Wirken in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Wirtschaft, über den besonders wichtigen Bereich der Medizin und vieles andere mehr sollen die Expertinnen und Experten sprechen, deren Fachgebiete davon berührt sind.
Aber: Wer überprüft die Ergebnisse? Geht die Recherche nur in eine Richtung? Fehlt etwas? Die KI ist nur so gut, wie die Informationen, anhand derer sie lernt. Wenn Quellen einseitig sind, entstehen die gefürchteten Bias.
Infobox
„Übermedien“ etwa schreibt über einen Exklusiv-Deal zwischen einem deutschen Verlagshaus mit OpenAI und wirft kritische Fragen dazu auf, und im OECD-Bericht zu Künstlicher Intelligenz in Deutschland heißt es: „Angesichts der immer schnelleren Entwicklung von KI besteht jedoch die Gefahr, dass sie Desinformation, wirtschaftliche Ungleichheit oder Biases fördert und dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit gefährdet.“ (11. Juni 2024)
Die KI kann nur so gut sein wie die Trainingsdaten, die ihr zur Verfügung stehen. In der Tagesschau wurde darüber berichtet, dass in den USA Archivbestände teilweise gelöscht werden, weil die Regierung gegen „Diversität, Gleichheit und Inklusion“ vorgehe. Der hierzu befragte Züricher Medienwissenschaftler Roland Meyer spricht von dem mit der „Säuberung der Archive“ verbundenen Risiko: „Sie verändere die Trainingsgrundlage für die sowie schon männlich dominierte künstliche Intelligenz“. Stereotype würden wiederholt und verstärkt. Wenn von den Websites der Regierungsbehörden etwa Bildmaterial von schwarzen Soldaten entfernt würde, wäre beim Befehl „Zeig mir einen Soldaten“ dieser dann „mit ziemlicher Sicherheit weiß“.
In einem weiteren Tagesschau-Artikel aus dem März 2025 wird beschrieben, dass Chatbots anfällig dafür sind, „russische Propaganda zu verbreiten“.
Je besser und vollständiger die Quellen, desto verlässlicher die Ergebnisse. Aber: Die KI braucht die Trainingsdaten in riesigen Mengen. In der Politik wird darüber diskutiert, wie diese als offene Daten zur Verfügung gestellt werden können. Das wiederum wirft Fragen nach dem Datenschutz auf. Wie so oft gilt: Alles hängt mit allem zusammen. Und nicht nur im oben genannten OECD-Bericht wird eine stärkere Einbeziehung der gesellschaftlichen Gruppen gefordert, um in der Diskussion all dieser Fragen Vertrauen in KI seitens der Bürgerinnen und Bürger aufzubauen.
„Bislang wurde KI positiv betrachtet, doch ihre rasche Weiterentwicklung und die daraus resultierenden Bedrohungen könnten dieses Vertrauen auf die Probe stellen und öffentlichen Widerstand gegen eine breitere Einführung hervorrufen. In einem Jahr mit wichtigen Wahlen werden Deepfakes und mittels KI erzeugte Desinformation die aufkommenden Bedrohungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Im Jahr 2024 wird eine beispiellose Anzahl von Wähler:innen in insgesamt 68 Ländern an die Wahlurnen gehen. Fälle von Deepfakes und Desinformation haben bereits in der Vergangenheit die Schlagzeilen beherrscht. Im ‚Superwahljahr‘ ist das Risiko, dass KI eingesetzt wird, um Fehl- und Desinformation zu erzeugen und zu verbreiten, besonders hoch. Ein derartiger Missbrauch könnte die Integrität demokratischer Prozesse untergraben und das öffentliche Vertrauen in KI schwächen.“
OECD-Bericht zu künstlicher Intelligenz in Deutschland
Es müssen Kriterien und Regulierungen entwickelt werden, die für alle gelten. Der europäische AI Act enthält hierfür Bestimmungen im Hinblick auf Anforderungen an und Verantwortung von Anbietern, Entwicklern und Nutzern – wobei mit letzteren in diesem Kontext nicht wir als Individuen gemeint sind, sondern diejenigen, die KI-Anwendungen wiederum in ihre Angebote integrieren. Hier werden verschiedene Risiko-Kategorien für KI-Anwendungen festgelegt und Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob entsprechende Anbieter in der EU oder einem Drittland ansässig sind, wenn sie risikoreiche oder hochriskanten KI-Systeme in der EU „in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen“. Dennoch gilt: Viele der großen Anbieter sind auf anderen Kontinenten zu finden.
Dies ist der rechtliche Rahmen. Mich interessieren darüber hinaus aber Qualitätskriterien. Es wird kaum möglich sein, diese allgemeinverbindlich zu entwickeln und dann auch festzuschreiben. Umso wichtiger bleibt auch hier unsere persönliche, medienkritische Kompetenz, Qualität von zweifelhaften Inhalten zu unterscheiden. Wir müssen unser Recht einfordern, an der Gestaltung der medial vermittelten demokratischen Gesellschaft teilzuhaben. Und wir müssen den Diskurs über Qualitätsmedien in jeglicher Form weiterführen und aus interdisziplinärem Wissen schöpfen.
Zum Stichwort Diskurs. Welche Pläne hast Du für den erneuerten Bereich „Grimme Diskurs“?
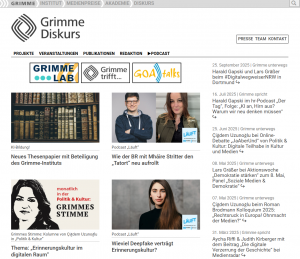
Die Agenda des Grimme Diskurses enthält einiges von dem, was ich bereits genannt habe: Im Austausch mit einem interdisziplinären Netzwerk von Expertinnen und Experten, Medienschaffenden, Menschen aus Politik, Wissenschaft und NGOs soll ein Monitoring der Mediengesellschaft entstehen, das genau mit dem Fokus auf Qualität Einschätzungen und Handlungsempfehlungen abgibt. Das Ziel ist es, mithilfe dieses Netzwerks, aber auch mit weiteren Projektpartnern Beiträge für eine Begleitung und Mitgestaltung zu konzipieren, um möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen verlässliche Informationen und damit eine Unterstützung bei Meinungsbildung, Teilhabe und Engagement zu liefern.
Hier im Grimme Lab machen wir einen kleinen Anfang mit unseren Dossiers zu wehrhafter Demokratie, Desinformation und digitaler Souveränität. An dieser Stelle reden nicht nur wir, sondern weitere Interviews zu Teilaspekten folgen. Als nächstes geplant ist eins zu digitaler Partizipation.




